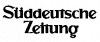Mit vollem Einsatz für das Sprechen
Der St. Vinzentius-Zentralverein legt in seinen Kindertagesstätten besonderen Wert auf die Sprachförderung – auch über die gesetzliche Verpflichtung hinaus. Ein Besuch im Kinderhaus St. Benedikt.
Vor dem Lernraum im Kinderhaus St. Benedikt stehen vier Kinder aufgeregt in einer Reihe. Nacheinander dürfen sie auf die Klingel neben der Tür drücken. „Guten Morgen, Marija!“, rufen sie. Was nach einem einfachen Satz klingt, haben sich die Kinder in den letzten Monaten mit Marija Botić erarbeitet. Anfang des Jahres sprachen alle hier kaum Deutsch, jetzt plappern sie schon munter drauf los – natürlich nicht einwandfrei, aber der Spaß an der Sprache und am Sprechen ist hier das Wichtigste. Dafür sorgt die Sprachpädagogin mit Spiel, Spontanität und viel Herz.
Ein neues Konzept für die Sprachförderung
Ihr Programm ist Teil des neuen Konzepts für Sprachförderung des St. Vinzentius-Zentralvereins. Seit Februar werden damit Kinder besonders gefördert, die Probleme beim Sprechen oder beim Erlernen der deutschen Sprache zeigen. „Wir können hier schon bei den Kleinsten mit zwei Jahren sehen, wer Unterstützung bei der Sprachentwicklung braucht, und wie unsere Mitarbeiter das frühzeitig umsetzen können. Dabei beschränken wir uns nicht nur auf den Sprachbereich, sondern nutzen alle Entwicklungsbereiche der Kinder, die dann zur Sprachentwicklung beitragen“, erklärt die pädagogische Gesamtleiterin der St. Vinzentius-Kinderhäuser, Peggy Tschung. Mit dem Konzept reagiert der Verein auf die Verpflichtung zur Sprachtestung für Kindertagesstätten in Bayern. Seit 2025 müssen alle Kinder mit viereinhalb Jahren zu einem Sprachtest in ihre Sprengelgrundschule. Wer hier durchfällt, muss an einem Sprachförderprogramm „Deutsch 240“ teilnehmen: 120 Stunden finden in der Grundschule statt, für die zweite Hälfte ist der Kindergarten zuständig.
Tschung sieht, dass diese Verpflichtung allein nicht reicht. Der St. Vinzentius-Zentralverein will weitergehen. „Die Spracheinschätzung mit Viereinhalb ist eigentlich schon viel zu spät. Wir wollen mit unseren Vorkursen schon die Jüngsten erreichen.“ Die Plätze in den Pflichtprogrammen sind knapp, erzählt sie. Wer im Kleinkindalter mit der Förderung beginne, könne handeln, bevor die Kinder kurz vor der Einschulung an den Sprachtests scheitern. Zentral dafür sind Ressourcen im Personal. Marija Botić ist in Vollzeit allein für die Sprachförderung angestellt. Zusammen mit ihr arbeiten drei Pädagogen für die Deutschkurse sowie eine ehemalige Deutschlehrerin im Minijob und eine Studentin der Sozialen Arbeit. „Das ist keine Selbstverständlichkeit“, gibt Tschung zu. „Der St. Vinzentius-Zentralverein hat als unser Träger die Kapazitäten so weit ausgedehnt, dass die Hilfe auch wirklich bei den Kindern ankommt.“
In allem steckt das Potenzial zum Lernen
Die Sprachförderung der Kinder will Botić nicht auf die Pläne und Programme begrenzen – und sie beginnt auch nicht erst im Lernraum des Hauses. Schon auf dem Weg dorthin gibt es eine Menge Gelegenheiten zum Sprechen und Üben. Sie holt die Kinder direkt aus ihren Gruppenräumen ab und geht mit ihnen in den Lernraum im dritten Stock des Gebäudes. Ihr ständiger Begleiter dabei ist die Kuscheltierkatze Kikus. Das Plüschtier hört den Kindern zu, ist für sie da und manchmal müssen sie auch ihr beim Lösen von Aufgaben helfen. „So wie andere mit Holz arbeiten, ist mein Werkzeug die Sprache“, erklärt die Pädagogin. Nach ihrem Studium der Germanistik arbeitete Botić mit Erwachsenen, Jugendlichen und Grundschülern, bis sie ihren Platz in der frühkindlichen Förderung in den Kinderhäusern des St. Vinzentius-Zentralvereins fand.
Im Eingangsbereich kommt die Gruppe an ihren selbst gebastelten Buchstaben vorbei: „Danke“ steht da aus buntem Papier an der Wand. Sie erinnern an den Erntedankgottesdienst vor einigen Wochen, den Botić mit ihren „Schülern“ gestaltet hat. „Wir waren alle begeistert. Kinder, die sich noch vor einigen Monaten kaum getraut haben zu sprechen, standen jetzt vorne in der Kirche und haben die Schöpfungsgeschichte dargestellt.“ Aktuelle Bezüge sind eine effektive Art, die Unterrichtseinheiten nah an den Kindern und ihren Lebensrealitäten auszurichten. Dafür können auch ganz einfache Gegenstände helfen. Nach den Sommerferien hat Botić die Eltern gebeten, den Kindern Urlaubsfotos mitzugeben. „So etwas hilft schon, damit die Kinder ins Erzählen kommen“, erinnert sich Botić. In ihrem Unterricht geht es vor allem darum, neue Wörter zu erlernen. Die Grammatik und Satzstrukturen werden dabei eher „mitgelernt“.
In dieser Stunde steht für die vier Kinder das Thema Herbst auf dem Plan. Mit Spielen wie Memory und Bingo, oder durch das eigene Entdecken, lernen sie zum Beispiel die unterschiedlichen Bedeutungen der Wörter Laub und Blätter kennen. „Dabei ist es ganz wichtig, dass wir so viele Sinne mit einbeziehen wie möglich.“ Wenn die Kinder einen Gegenstand fühlen, das Wort dafür hören und den Namen dann selbst laut aussprechen, klappt es mit dem Merken am besten. Nico greift beherzt in die abgedeckte Schale hinein und fühlt: „Das sind Blätter!“. Richtig – aber in der nächsten Schale sind ebenso Blätter, meint er. Den Unterschied kann er fühlen: die einen sind trocken und rascheln ganz anders. Ein Blick unter das Tuch verrät ihre braune Farbe. In einer Schale hat Botić Laub versteckt, in der anderen sind es Blätter, noch grün und frisch vom Baum.
Mit Spaß und Empathie zum Erfolg
Dass das Konzept funktioniert, misst Tschung vor allem daran, „dass die Kinder unheimlich gerne in diese Sprachkurse gehen, weil sie klein sind, weil sie individuell sind und weil die Kollegen das nötige Herzblut mitbringen.“ Botić stimmt ihr zu. Die Entwicklungsfortschritte seien bei den Kindern ganz deutlich zu sehen. Im Vordergrund stehe dabei die genaue Artikulation von Wünschen und Bedürfnissen. „Wo früher nur ein Wort war, ist jetzt ein ganzer Satz.“ Aber auch in der Gesprächsführung sei ein Unterschied zu spüren; die Kinder seien ausgeglichener und ruhiger. „Dabei wird auch die Empathie gefördert“, zum Beispiel durch das Üben von Blickkontakt beim Sprechen oder durch das Ausredenlassen.
Die beiden hoffen, dass durch ihre Arbeit weniger Kinder in den nächsten Jahren in die Vorkurse der Grundschule müssen – damit ihr Umgang mit Sprache von Anfang an durch Spaß und Empathie geprägt ist.
Wir in den Medien:
Klicken Sie auf die Berichte aus den Medien: